Kreativität ist für uns ein ganz normales Phänomen. Wir verstehen sie als Kompetenz, mit deren Hilfe wir etwas Neues oder Schönes erschaffen und Probleme lösen können. Im Job, bei der Einrichtung der neuen Wohnung oder vor unserem Kühlschrank, wenn wir aus dessen überschaubaren Inhalt ein leckeres Gericht zaubern müssen. Das entscheidende ist: Wir alle sind kreativ. Jeden Tag!
Das war aus gesellschaftlicher und wissenschaftlicher Sicht nicht immer so. Früher wurde Kreativität als göttliche Eingebung verstanden. Der Mensch fungierte quasi als Kommunikationsmedium einer höheren Entität, die sich über das ästhetisch Wertvolle auszudrücken versuchte. Aus diesem Grund unterlag Kunst nicht selten der Zensur elitärer Gruppen und religiöser Institutionen, die vorgaben, was als wertvoll zu gelten hat und was eben nicht. Kreativität war so den wenigen Genies und Hochbegabten vorbehalten. Diese Sichtweise manifestiert sich auch heute noch im historischen Narrativ der alten Meister in der Malerei, Musik und Dichtung. Kreativität ist hier klar auf das ästhetische Schaffen beschränkt, jedoch ohne den Faktor der Wirtschaftlichkeit.
Die Entstehung der Creative Industries

Von Kreativität als Wirtschaftstätigkeit wird tatsächlich erst seit den 1990er Jahren gesprochen, als in England der Begriff der Creative Industries geprägt wurde. Dieser schwappte kurzerhand auch nach Deutschland, wo wir seitdem von der Kultur- und Kreativwirtschaft (KuK) sprechen. Wenn wir uns heute während der Corona-Krise darüber wundern, warum die KuK so hart um Anerkennung und Gleichbehandlung mit anderen Wirtschaftszweigen kämpfen muss, liegt dies auch an ihrer Jugendlichkeit und den noch immer vergleichsweise wenig organisierten Strukturen.
Den Grundstein dafür, wie wir heute über Kreativität (auch im wirtschaftlichen Sinne) denken und forschen, legte 1950 der Psychologe Joy Paul Guilford, der die damals durchaus kontroverse Behauptung aufstellte, dass jeder Mensch kreativ sein könne. Damit entstand eine neue Dynamik in der bis dato vernachlässigten Kreativitätsforschung und es wurden vermehrt empirische Studien durchgeführt. Letztlich hat dieser Paradigmenwechsel dazu geführt, dass sich Kreativität von der Idee emanzipieren konnte, es ginge dabei ausschließlich um das ästhetische Schaffen eines Genies oder einer Hochbegabten.
Erst mit dieser neuen Denkweise ergab es Sinn, kreatives Schaffen in einem wirtschaftlichen Sinne von der alltäglichen Kreativität gewissermaßen abzukoppeln. Der Wissenschaftler Henning Beck stellt in einer seiner Publikationen heraus, dass unser Gehirn gar nicht anders könne, als permanent neue Ideen, Muster und Gedanken hervorzubringen. Doch unterscheidet sich diese permanent stattfindende Hirnaktivität vom kreativen Schaffen in einem wirtschaftlichen Kontext?
Zwei Arten des Denkens
Um Kreativität neurowissenschaftlich verstehen zu können, ohne dabei zu tief zu gehen, sind zwei verschiedene Arten des Denkens entscheidend: das konvergente und das divergente Denken. Beim konvergenten Denken gehen wir analytisch und rational vor. Wir suchen die Gegebenheiten nach Details ab, die für die Lösung eines Problems entscheidende Hinweise geben könnten. Dieses kommt z.B. im Bereich der Mathematik zum Einsatz, wenn es eine Zahlenreihe zu vervollständigen gilt, wie Beck in einem Video für GEO anschaulich erklärt. Hierbei werden verschiedene Möglichkeiten ausprobiert, bis die passende gefunden ist. Es handelt sich um einen bewussten Vorgang.
Divergentes Denken ist dem genau entgegengesetzt. Anstatt sich ganz bewusst der Problemstellung zu widmen, schweifen die Gedanken ab und wenden sich vermeintlich belanglosen Dingen zu, wie Beck erklärt. Dadurch kann ein Freiraum entstehen, der andere und womöglich abwegige Lösungsstrategien ermöglicht. In der Psychologie wird laut Beck von dem “Aha-Erlebnis” gesprochen, das hier mal nichts mit Masken, Abstand und Corona zu tun hat. Beim Aha-Erlebnis kommen wir scheinbar plötzlich und wie aus dem Nichts auf eine Idee oder eine Lösung, obwohl wir uns gar nicht bewusst damit beschäftigt hatten. Auch wenn wir uns gedanklich von einer Problemstellung abwenden, weil wir nicht weiterkommen, frustriert sind oder schlicht keine Lust mehr haben, arbeitet das Gehirn weiter an diesem Problem, ohne dass wir dies bewusst steuern. Dementsprechend sind beim divergenten Denken andere Hirnreale aktiviert als beim konvergenten Denken.
Beim Lösen von Problemen und auch beim kreativen Denken findet ein stetiger Wechsel dieser beiden Modi statt. Die bewusst gesammelten Informationen und Details beim konvergenten Denken werden in der unbewussten Phase des divergenten Denkens mit ganz anderen Dingen und Sachverhalten zusammengebracht und es werden neue Muster und Zusammenhänge erzeugt. Es entstehen neue Verknüpfungen im Gehirn. Beim bewussten Vorgang der Problemlösung oder der Entwicklung einer kreativen Idee sind genau diese neuen, unbewussten Verknüpfungen von entscheidender Bedeutung. Und so kann auch das Gefühl entstehen, eine Idee käme aus dem Nichts, was wahrscheinlich früher zu der Vorstellung von göttlicher Eingebung geführt hat.
Sind wir alle Kreativschaffende?

© Clark van der Beken
Wir alle sind kreativ. Doch das bewegt uns noch lange nicht dazu, ästhetische Dinge zu produzieren, deren Nützlichkeit gerade in deren Ästhetik selbst zu liegen scheint. Es ergibt also sicherlich Sinn, die alltägliche Kreativität vom künstlerischen Schaffen abzugrenzen. Eine erste solche Unterscheidung ließe sich an einem konkreten Content festmachen. Während die alltägliche Kreativität weitgehend unsichtbar bleibt und sich so auch nur schwer vergleichen und erst recht nicht vermarkten lässt, erzeugen Kreativschaffende innovative, neue oder ästhetische Produkte, die wirtschaftlich einen Wert haben.
Diese Motivation, nicht einfach nur Probleme zu lösen, wenn sie auftauchen, sondern gewissermaßen aus dem Nichts etwas explizit Neues, Innovatives oder Ästhetisches zu schaffen, unterscheidet die kreative Arbeit von der Kreativität im Alltag. Diese Motivation kann intrinsisch sein, also im Spaß am kreativen Schaffen selbst liegen. Aber sie kann auch extrinsisch begründet sein, wie z.B. durch den Wunsch berühmt zu werden oder gesellschaftliche Anerkennung zu bekommen. Und genau diese Motivation zeichnet Kreativschaffende aus.
Hinter jedem kreativen Produkt stehen Entscheidungsprozesse. Wer etwas Neues hervorbringt, hat die freie Wahl, wie dieses am Ende aussehen bzw. klingen soll. Hier lässt sich Kreativität aktuell auch noch von Künstlicher Intelligenz abgrenzen. Denn wie z.B. Eugen Gross im Interview erklärt, geht es bei Kreativität um genau diese Entscheidungsprozesse, an deren Ende eben jenes Neue steht. Im Gegensatz dazu spielen Algorithmen und Neuronale Netze nur genau das aus, was ihnen durch die Daten zur Verfügung gestellt wird. Wenn eine Künstliche Intelligenz mit Daten von dem Komponisten Schubert gefüttert wird, um daraus dessen unvollendete Symphonie zu vervollständigen, ist es keine Überraschung, dass am Ende etwas herauskommt, das nach Schubert und nicht nach Taylor Swift klingt.
Es ließe sich sagen, dass Maschinen ausschließlich konvergent “denken”, ihnen aber die Fähigkeit des divergenten Denkens fehlt. Aber genau das ist ausschlaggebend dafür, um neue Zusammenhänge, Muster und Ideen zu entwickeln, damit am Ende eben nicht Schubert, sondern etwas Neues herauskommt.
Was Maschinen nicht können
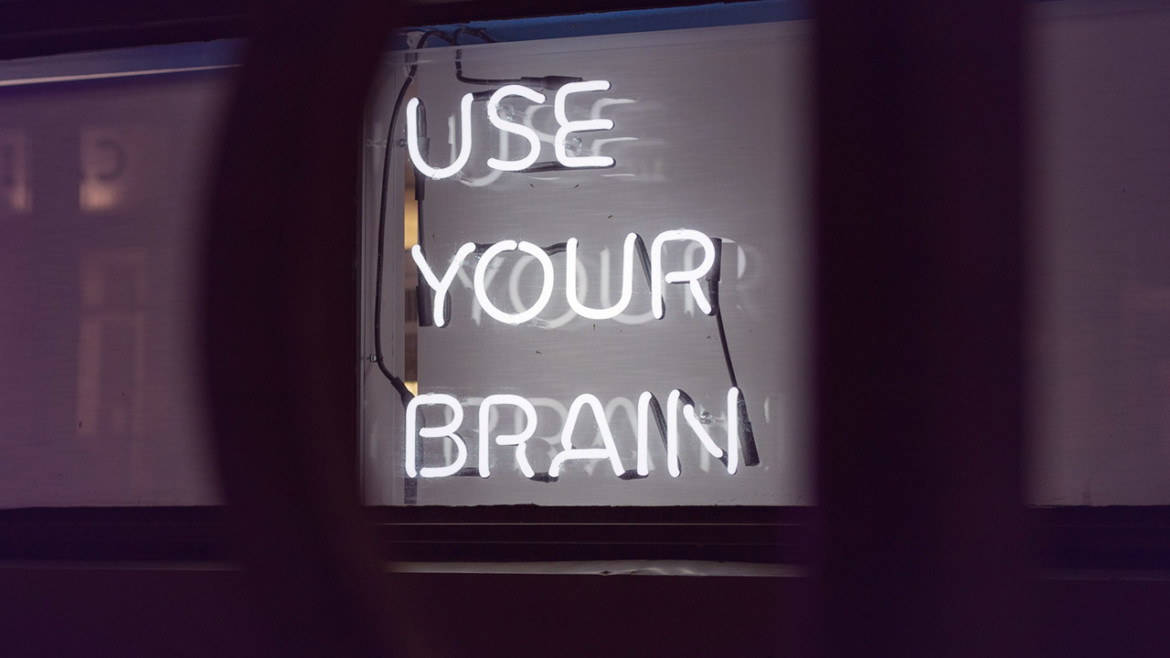
© Jesse Martini
Trotzdem gibt uns die Arbeitsweise der Künstlichen Intelligenz Aufschluss über unser eigenes kreatives Denken, Handeln und Schaffen. Denn im Wechselspiel der beiden Modi des Denkens werden Informationen, Wissen und Details gesammelt und in neue Zusammenhänge gebracht. Genauso wie die bei den Maschinen basiert auch die menschliche Kreativität gewissermaßen auf Daten. Umso mehr vorhanden und abrufbar sind, umso kreativer kann das Endprodukt werden. Deshalb wird Kreativität inzwischen immer häufiger entlang von Intelligenz und Bildung verhandelt und auch umgekehrt. Was uns von den Maschinen unterscheidet, ist die Fähigkeit, eigenständig Daten aus den verschiedensten Bereichen zu sammeln, zu organisieren und selbstentschieden in einen kreativen Output zu überführen.
Kreativität und dessen Wirtschaftlichkeit ist ein noch relativ junges Phänomen in unserer Gesellschaft, aber es gewinnt immer mehr an Bedeutung: als Wirtschaftsfaktor, als gesellschaftliches Moment des Zusammenhalt, im Rahmen von Intelligenz und Bildung, wie auch in den Disziplinen der Soziologie, Psychologie und Neurowissenschaft. Außerdem spielen die Produkte der Kultur- und Kreativwirtschaft eine entscheidende Rolle bei der Frage, wer wir sind und sein möchten. Denn unsere Identifikation findet fast immer in kreativem Content einen Bezugspunkt, sei es ein Musikstück, ein Bild oder eine Theater-Performance.
Die Corona-Krise hat uns gezeigt, wie wichtig die Arbeit der Kreativschaffenden für unsere Gesellschaft ist. Motivation ein enorm wichtiger Faktor für die Erstellung kreativen Contents. Deshalb ist es so wichtig, die KuK zu unterstützen und die Arbeitsbedingungen der in ihr Beschäftigten zu verbessern, die viel zu oft unter der Armutsgrenze leben. Corona wird uns mit all den Unsicherheiten auch 2022 weiter begleiten. Möge die neue Regierung ihre Versprechen einhalten und die Förderstrukturen noch weiter ausbauen.

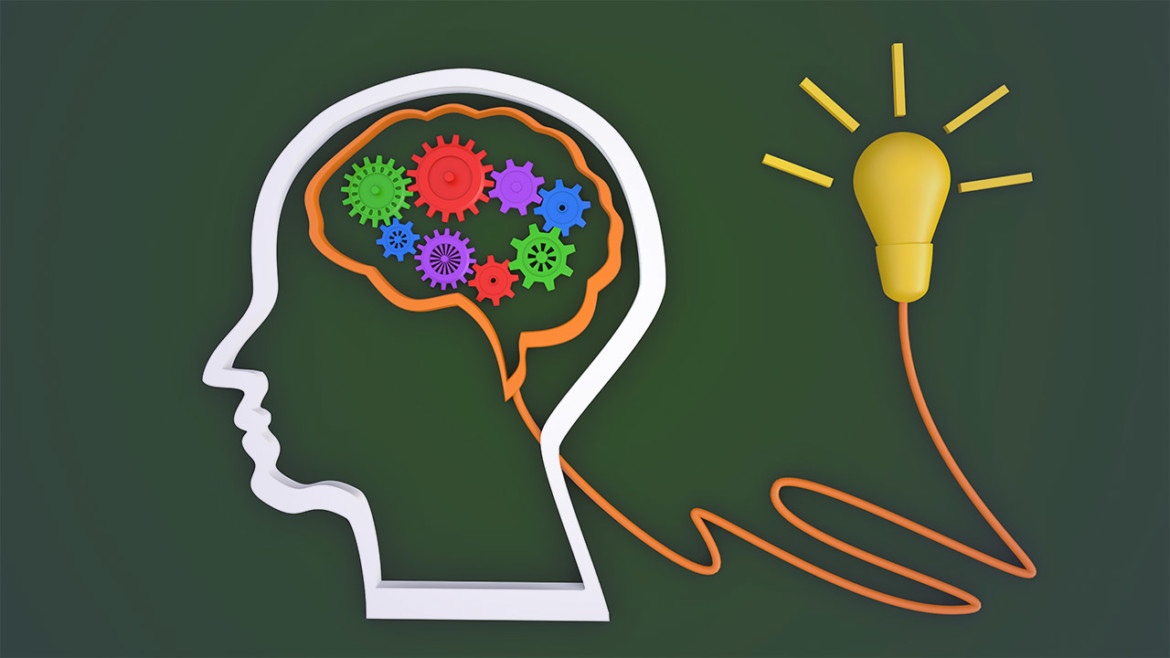




Hinterlasse einen Kommentar